I. Die Französische Revolution
Das Bürgertum
Das Bürgertum hatte sich Ende des 18. Jahrhunderts zu Wohlstand und Selbstbewusstsein hochgearbeitet. Die Grundlage seines Reichtums bildete hierbei das eigene Kapital und nicht wie beim Adel oder bei den Geistlichen der Großgrundbesitz. Doch auch trotz seiner angesehenen Stellung innerhalb des Staates, wurde dem Bürgertum keinerlei politisches Mitspracherecht gewährt. Ebenso fühlte sich das Volk vom Adel bevormundet und verachtet, so dass die Denkrichtung der Aufklärung über eine Änderung der bestehenden Gesellschaftsordnung beim Bürgertum auf positiven Zuspruch stieß. Die Revolutionen in England (1688 – 1689) und vor allem der Unabhängigkeitskrieg in Amerika (1776 – 1783) machten auf das französische Volk hierbei einen tiefen Eindruck.
Das Scheitern der Reformversuche Ludwigs XVI.
Der damalige amtierende König
Ludwig XVI. erwies sich als sehr reformfreudig und wollte nachholen, was die
bisherigen französischen Herrscher bisher ausgelassen hatten: eine Besteuerung
der ersten beiden Stände. Nach dem alten Gesetz genoss der Adel völlige
Steuerfreiheit, die Geistlichen wurden nur zu bestimmten regelmäßigen Abgaben
verpflichtet. Die gesamte Steuerlast lag daher auf den Schultern des einfachen
Volkes. Das Bürgertum war zwar aufgrund seines Reichtums durchaus in der Lage,
diese neuen Steuern zu bezahlen, jedoch kritisierte man die steuerliche
Bevorzugung des Adels und der Geistlichen.
Der daraufhin beschlossene
Versuch der Regierung, die unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Klassen
aufzuheben, scheiterte an der Opposition der bevorrechteten Stände. Dies machte
nur allzu deutlich, dass die Monarchie in Frankreich schwach und ohnmächtig
gegenüber Adel und Geistlichen war.
Der Beginn der Revolution
Der französische Staat geriet –
unter anderem ausgelöst durch den
Siebenjährigen Krieg – immer tiefer in
finanzielle Not, nicht zuletzt durch die gescheiterten Steuerreformversuche. Um
den drohenden Staatsbankrott zu verhindern, berief der König im Frühjahr 1789
die Generalstände (Vertreter der drei Stände) zu sich. Ursprünglich war jeder
Stand durch 300 Vertreter repräsentiert, jetzt wurde dem dritten Stand – den
Bauern- und Bürgertum – aufgrund seiner Bedeutung das doppelte an Plätzen
zugestanden. Eine Abstimmung nach Köpfen jedoch wurde verweigert. Auch sollte
nur über die Finanzfrage und nicht wie vom dritten Stand gefordert, über die
Verfassungsfrage diskutiert werden. Sofort nach Beginn der Zusammenkunft der
Generalstände, begann daraufhin die Abstimmungsfrage.
Nachdem die drei Stände
wochenlange, aber ergebnislose Streitgespräche führten, erklärte schließlich der
Stand des Bauern- und Bürgertums, dass er allein die französische Nation
vertrete und forderte die anderen Stände auf, sich ihm anzuschließen. Viele
niedrige Adlige und Geistliche folgten, verstanden sich fortan als
„Verfassungsgebende Nationalversammlung“ und leisteten im Ballhause den Schwur,
nicht eher auseinander zu gehen, bis der französische Staat über eine Verfassung
verfüge. Mit diesem Ballhaus-Schwur begann am 20. Juni 1789 die Revolution.
Denn als der König von der Versammlung forderte, auseinander zugehen, rief der
Führer des dritten Standes,
Graf Mirabeau: „Wir sind hier kraft Vollmacht der
Nation und werden nur der Macht des Bajonette weichen“. Darauf gab Ludwig XVI.
nach.
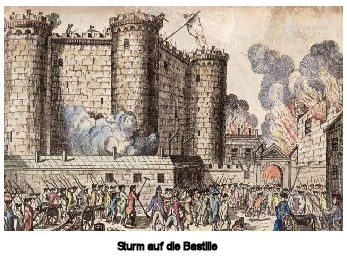 Zur
gleichen Zeit begannen die Unruhen in Paris. Am 4. Juli 1789 stürmte das
Volk die Bastille, da es dort Gefangene des Königs vermutete. Der Befehlshaber
und die Garnison des Staatsgefängnisses wurden von den Maßen getötet.
Zur
gleichen Zeit begannen die Unruhen in Paris. Am 4. Juli 1789 stürmte das
Volk die Bastille, da es dort Gefangene des Königs vermutete. Der Befehlshaber
und die Garnison des Staatsgefängnisses wurden von den Maßen getötet.
Die Beschlüsse der
Nationalversammlung standen unter dem Zeichen der Losung „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit" und all ihre Arbeit berief sich auf die Bürger- und
Menschenrechte, wie sie auch Jahre zuvor schon in Amerika verwirklicht wurden.
Im Laufe der Zeit verzichtete
der Adel auf alle seine Vorrechte gegenüber dem dritten Stand und ließ die
Leibeigenschaft der Bauern aufheben. Um einen Teil der Staatsschulden abzubauen,
wurde Besitz der Kirche zum Staatseigentum erklärt (Säkularisation). Weitere
Beschlüsse folgten. Das französische Volk bestand nunmehr nicht aus drei
unterschiedlichen Schichten, sondern verstand sich als eine Summe von
freien und gleichberechtigten Staatsbürgern. Frankreich wurde zu einer
konstitutionellen Monarchie im Sinne
Montesquieus, in der die Gewaltenteilung
streng durchgeführt wurde.
Die Anfänge der Französischen
Revolution fanden bei vielen deutschen Dichtern und Denkern beigeisterte
Zustimmung. Klopstock und Schiller erhielten das französische Ehrenbürgerrecht, nur Goethe
sah in einer gewaltsamen Revolution nicht das richtige Mittel für eine
politisch-soziale Veränderung.
Nachdem die erste
Verfassungsgebende Nationalversammlung ihre Arbeit beendet hatte, folgte die
Gesetzesgebende Nationalversammlung, auf der sich die radikal-politischen
Jakobiner, unter denen die republikanischen
Girondisten das Übergewicht
hatten, als federführend bewiesen.
Seit dem Ausbruch der Revolution war die Spannung zwischen dem konstitutionellen Frankreich und den restlichen europäischen Staaten ständig gewachsen. Die revolutionäre Aufbruchstimmung, die französische Emigranten in anderen Ländern Europas verbreiteten, konnte den dort herrschenden Regierungen nur ein Dorn im Auge sein. Frankreich wurde zunehmend mit Misstrauen betrachtet, so taten die Staatsmänner in Paris doch alles, um die freiheitlich-fortschrittlichen Ideen der Revolution überall zu verbreiten. Am 20. Juli 1792 drängten die Girondisten auf eine Kriegserklärung gegen Österreich, um das französisch-politische Interesse nach außen zu lenken. Nach der französischen Kampfansage gegen Österreich stellte sich sogleich Preußen auf dessen Seite. Als Reaktion auf das Koblenzer Manifest des Oberbefehlshabers der österreichischen-preußischen Armee, in dem in radikaler Form die bedingungslose Wiederherstellung der Monarchie in Frankreich als Kriegsziel der Koalition formulierte wurde, stürmte im August 1792 die Pariser Bevölkerung die Tuilerien, den Sitz des Königs. Ludwig XVI. wurde abgesetzt und zusammen mit seiner Familie inhaftiert. In der folgenden Zeit wurde die Wahl eines Nationalkonvents beschlossen, der im September 1792 sogleich die Republik ausrief. Ludwig XVI. wurde wenige Monate später wegen Landesverrats hingerichtet.
Die ersten Koalitionskriege (1793 – 1797)
Nachdem sich Preußen bereits mit
Österreich verbündet hatte, folgten im September die deutschen Staaten Baden und
Hessen-Kassel dem preußischen Vorbild.
Noch im selben Jahr überschritten die französischen Truppen die belgische Grenze
und marschierten in Brüssel als Sieger ein. Auch wurden Mainz und Frankfurt am
Main von den Franzosen besetzt. Frankreich erklärte, zukünftig allen Ländern
Beistand leisten zu wollen, die sich vom Despotismus (Gewaltherrschaft) ihrer
Regierungen befreien möchten. Die Parole „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“
breitete sich rasch in ganz Europa aus.
Doch schon bald wurde Europa
klar, mit welchen Gedanken Frankreich wirklich in diesen
ersten Koalitionskrieg
gezogen war. Nicht an der politischen Befreiung der europäischen Länder war es
den Franzosen gelegen, vielmehr wollte man dem eigenen Land Vorteile
verschaffen. So wurden zum Beispiel die rheinischen Städte aus diesem Grund
„befreit“, um Frankreich den Rhein als natürliche Grenze zu sichern. Am 1.
Februar 1793 erklärte Frankreich Großbritannien und Holland den Krieg, bald
darauf auch Spanien.
England erkannte nun den Ernst
der Lage und schloss mit allen frankreichfeindlichen Staaten Verträge ab, um
sich gegen die wachsende französische Gefahr zu wehren. Innerhalb kürzester Zeit
schlossen sich Preußen, Österreich, Holland, Spanien und Sardinien dem
englischen Reich an. Im ersten Jahr der Koalitionskriege musste die
französische Seite schwere Niederlagen gegenüber der Koalition in Kauf nehmen.
Frankreich begriff schnell, dass
es den Krieg auf die bisherige Weise nur schwer gewinnen konnte. Durch die so
genannte „levée en masse“, einer französischen Massenbewegung, eine
neue Kriegstaktik sowie Strategie, fügte man der Koalition ab dem Jahr 1794
empfindliche Niederlagen zu.
Während die Franzosen unter
Darbietung all ihrer Kräfte den Verbündeten schwere Verluste zufügten, schied
Preußen im April 1795 aus der Koalition mit den anderen europäischen Staaten aus
und verzichtete mit dem Sonderfrieden zu Basel auf seine linksrheinischen
Gebiete. Spanien tat es Preußen im Juli desselben Jahres gleich und trat
ebenso aus dem Bündnis aus.
Aufstieg Napoleons
Zu Beginn 1796 verlagerte sich
der Kriegsschauplatz des Koalitionskriegs nach Italien. Hiermit begann der
Aufstieg des Napoleon Bonapartes.
 Der
ursprünglich aus Korsika stammende
Napoleon errang zwar kleine, aber durchaus
bedeutsame Siege im innern Frankreichs und wurde als Lohn für seine Taten zum
Oberbefehlshaber im italienischen Feldzug ernannt.
Der
ursprünglich aus Korsika stammende
Napoleon errang zwar kleine, aber durchaus
bedeutsame Siege im innern Frankreichs und wurde als Lohn für seine Taten zum
Oberbefehlshaber im italienischen Feldzug ernannt.
In knapp einem Jahr hatte
Napoleon die Österreicher aus Italien vertrieben. Im Frieden zu Campo Formio im
Oktober 1797 verpflichtete sich Österreich daraufhin, seine linke Rheinuferseite
an Frankreich sowie die Österreichischen Niederlande und Mailand an Frankreich
abzutreten.
Als Hauptgegner blieb nur
noch England übrig, nachdem Preußen durch den Sonderfrieden und Österreich durch
den Frieden zu Campo Formio keine Bedrohung mehr für die Franzosen darstellten.
Bei seiner Expedition nach Ägypten, sollte
Napoleon auf Befehl des französischen
Konvents die Engländer in seinen Kolonien treffen. Doch gegen die britische
Flotte musste er im August 1798 eine vernichtende Niederlage hinnehmen. Als
Bonaparte erfuhr, dass ein neuer Krieg in Europa ausgebrochen war, kehrte er im
Oktober 1799 umgehend dorthin zurück.
Napoleons Machtübernahme
Der französische Nationalkonvent hatte es nicht verstanden, sich rechtzeitig das Vertrauen der Nation zu sichern. Das Versagen auf politischer Ebene führte dazu, dass sich das Volk immer mehr von der Herrschaft des Direktoriums abwandte und sich nach der Herrschaft eines starken Mannes sehnte, der Frieden und Ordnung im Lande einkehren lassen sollte. Napoleon, der bei seiner Rückkehr nach Frankreich mit riesigem Jubel begrüßt wurde, war es demnach ein leichtes, den unsicheren Verhältnissen des Landes mit Hilfe der Armee ein Ende zu setzen. Äußerlich blieb Frankreich eine Republik, in Wahrheit entwickelte es sich jedoch zu einer Militärmonarchie, an dessen Spitze Napoleon Bonaparte als Erster Konsul seit dem 9./10. November 1799 fungierte.
Der zweite Koalitionskrieg (1798 – 1801)
Während sich Bonaparte noch in Ägypten aufhielt, schlossen England, Russland und Österreich Ende 1798 / Anfang 1799 eine neue Koalition gegen Frankreich. Auch hier zeigten sich die Armeen der Koalition anfangs als recht erfolgreich, im norditalienischen Marengo wendete sich jedoch 1800 das Waffenglück. Napoleon errang einen entscheidenden Sieg über die Österreicher. Im Frieden zu Lunéville im Februar 1801 verzichtete der österreichische Kaiser Franz II. öffentlich in Namen des Deutschen Reiches auf das linke Rheinufer. Somit wurde Frankreich ein Gebiet zugesprochen, in dem fast vier Millionen Quadratmeter Landfläche für Deutschland verloren gingen. Die deutschen Fürsten wurden für die dadurch entstandenen Verluste mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 entschädigt. Nach langen Verhandlungen kam es 1802 zum Frieden von Amies zwischen Frankreich und England.
Der Reichsdeputationshauptschluss
Auf dem Reichsdeputationshauptschluss in Regensburg wurde im Einverständnis mit Napoleon folgendes festgelegt: Aufhebung aller geistlichen Fürstentümer (Säkularisierung), 45 Reichsstädte und 1.500 Reichsritterschaften wurden einem einzigen Landesherrn unterstellt (Mediatisierung). Hiermit wurden die drei Stände des Reiches beseitigt, was auch zur Folge hatte, dass der Reichsgedanke erhebliche Einbußen erleiden musste.
Der dritte Koalitionskrieg (1805)
Der Friede von Amies hielt praktisch gesehen nur ein Jahr. England und Frankreich rüsteten sich erneut zum neuen Koalitionskampf. Napoleon, der sich ein Jahr zuvor selbst zum Kaiser Frankreichs gekrönt hatte, traf hierbei seine Vorbereitungen zu einer Invasion Englands. England gelang es erneut, Österreich und Russland in einer Koalition zusammenfassen, nur Preußen ließ sich auch nach langen Verhandlungen nicht dazu bringen, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen. Doch auch dieses Mal sollte die Koalition keinen Sieg am Ende erringen. In der entscheidenden „Dreikaiserschlacht“ zu Austerlitz am 2. Dezember 1805 besiegte das französische Herr die Verbündeten Österreich und Russland. Österreich kapitulierte erneut und unterzeichnete Ende Dezember den Frieden von Pressburg.
Der Rheinbund und das Ende des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“
Nach dem Sieg bei Austerlitz verhalf Napoleon seinen deutschen Verbündeten – Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt – zu Rangerhöhungen und wertete die Regionen in Königreiche oder Großherzogtümer auf. Einige Zeit später sagten sich die Fürsten dieser Gegenden zusammen mit anderen südwestdeutschen Fürstentümern vom Reich los und schlossen den Rheinbund, als dessen Protektor sie Napoleon Bonaparte anerkannten. Insgesamt bestand der Rheinbund aus 16 Fürsten, die sich auch militärisch der französischen Herrschaft beugten. Folgerichtig legte Franz II. die Kaiserkrone nieder und erklärte die deutsche Kaiserwürde für erloschen. Das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ war damit 1806 beendet.
Der vierte Koalitionskrieg (1806/07)
Angesichts der dauernden
französischen Demütigungen gegenüber Deutschland, verlangte der König von Preußen
Friedrich Wilhelm III. die Bildung eines norddeutschen Bundes nicht zu behindern
und forderte im September 1806 von
Napoleon den Rückzug der Franzosen aus
Deutschland. Napoleon
beantwortete das preußische Ultimatum jedoch nicht,
marschierte anstatt dessen in Thüringen ein und schlug Preußen im Oktober 1806
auf vernichtende Weise.
Doch trotz seiner Niederlage
führte Preußen mit Hilfe Russlands den Krieg gegen Frankreich fort, bei der
Schlacht bei Preußisch-Eylau (1807) trennten sich die französische und
russische Armee unentschieden. Nach dem französischen Sieg über die Russen bei
Friedland, knüpfte Napoleon jedoch Kontakt mit dem russischen
Zar Alexander I.,
der daraufhin seine preußischen Verbündeten im Stich ließ.
Napoleon hatte
Zar
Alexander I. davon überzeugt, dass sich Frankreich und Russland die
Weltherrschaft teilen müssten, um den ersehnten Frieden in der Welt
wiederherzustellen. Auch sollte durch eine Erniedrigung Englands die Freiheit
der Meere wiederhergestellt werden. Aus diesem Grund trat
Zar Alexander I. der
Kontinentalsperre gegen England bei, die Kaiser Bonaparte im November 1806
verkündete. Jeglicher Handel und Briefwechsel mit England wurde hierauf
verboten.
Nun war es der preußische König,
der die Kosten der französisch-russischen Freundschaft tragen musste. Zwar wurde
Preußen nicht vollkommen zerschlagen, musste aber im Frieden von
Tilsit (7./9.
1807) fast die Hälfte seines Gebietes abtreten und verpflichtete sich, eine fast
unbezahlbare Kriegsentschädigung zu entrichten. Das preußische Heer durfte nicht
mehr als 42.000 Mann betragen, zudem hatte es die Pflicht, dem französischen
Kaiser Heeresfolge zu leisten. Mit
Tilsit erreichte Frankreich den Höhepunkt
seiner Machtentfaltung.
III. Die geistige Vorbereitung der Freiheitskriege
Das politische Leben in Deutschland um 1800
Der absolutistische Staat hatte
seine Untertanen nicht am politischen Leben teilhaben lassen, daher war ihm auch
der politische Gedanken fast vollkommen fremd geworden. Das öffentliche Leben
ging in Deutschland weitgehend unter und mit dem Reichtum des deutschen
Geisteslebens war ein Tiefstand des politischen Lebens verbunden.
Der Patriotismus galt unter den
Gebildeten als eine geistliche Enge, der eines philosophisch-gebildeten Mannes
nicht würdig sei. Lessing zum Beispiel nannte den Patriotismus eine „heroische
Schwachheit“ und selbst Schiller forderte die Deutschen dazu auf, sich nicht zur
Nation, sondern zu Menschen zu bilden. Die Gleichgültigkeit am politischen
Geschehen der Deutschen zeigte sich insbesondere darin, dass der Verlust der
linken Rheinuferseite auf die Menschen keinen Eindruck machte. Der Gedanke nach
einem vereinten Deutschland war in weiter Ferne.
Die Romantik findet in die politische Wirklichkeit zurück
Eine Reihe von Dichtern, die man
als Romantiker bezeichnete, betrachtete das Volk nicht mehr als Summe von
Einzelmenschen, sondern als etwas Einmaliges. Das Volk besaß
ihrer Meinung nach eine ihm eigene Geschichte und das Recht auf eine angemessene Verfassung. Nach dieser Anschauung ließ sich das Leben des Volkes
nicht mehr mit der Vernunft begründen, sondern das Volk entwickelte sich nach
Gesetzen, die denen der Pflanzenwelt ähnelten. Seine Entwicklung war organisch.
Allmählich gewannen die
Romantiker zunehmend Interesse an der eigenen Geschichte, durchreisten
die deutschen Landschaften und erfüllten sich mit Begeisterung für das
Mittelalter, für die
Gotik und für
Albrecht Dürer. Sie schufen selber eigene
Märchen und sammelten längst vergessene Kulturschätze an Volksliedern,
Volksbüchern, Märchen und Sagen. Die romantische Bewegung läutete somit eine
neue Denkrichtung in Deutschland ein.
Deutschland und die Französische Revolution
Die Französische Revolution von 1789 bestärkte den Gedanken des Weltbürgertums der Deutschen nur noch umso mehr. Der Beginn einer neuen Zeit wurde von vielen heftig gegrüßt. Waren die Hoffnungen nach Brüderlichkeit und Sieg der Vernunft nur in Gedanken für möglich gehalten, zeigte die Revolution der Franzosen, dass es auch in der politischen Realität durchaus gelingen konnte. Zeigten die Deutschen noch Gefallen an den Grundzügen von 1789, so wandelte sich dieses schnell ins Gegenteil, als man mit ansehen musste, zu welchen Ausartungen der Umsturz geführt hatte.
Die Geburt des neuen deutschen Nationalbewusstseins
Bedeutender als die Abscheu vor der Revolution, war jedoch die ständig wachsende politische Not der Deutschen, ausgelöst durch die französische Fremdherrschaft. Ihr völkerfeindlicher Imperialismus zeigte die Franzosen von ihrer schlimmsten Seite. In dieser Zeit der Unterjochung durch die Franzosen wurde in Deutschland ein neues Nationalbewusstsein geboren. Volk und Vaterland standen nun über allem, für das jeder sein Äußerstes gab. Auf diese Weise kamen Volk und Staat zusammen und bildeten eine Einheit. An dieser Aufgabe arbeiteten Dichter, Philosophen, Theologen und andere Männer mit. Ihre Ideale waren hierbei die von der Romantik neu wiederbelebten Gedanken an Glaube, Volk und Vaterland.
Die Universität Berlin
Aus Gründen der Humanität gründete Wilhelm vom Humboldt die Universität in Berlin, die König Friedrich III. mit folgenden Worten einweihte: „Der Staat soll durch geistige Kräfte ersetzen, was er an materiellen verloren hat.“ Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, der sich in der Universität Berlin an das deutsche Volk mit seinen „Reden an die deutsche Nation“ 1807/08 wandte, forderte in diesen, dass das deutsche Volk um der Menschheit Willen erhalten bleiben müsse und es zu seiner Sicherung eines starken nationalen Staates bedürfe.
Die Presse und das Turnen
Enttäuscht von der
Gewaltherrschaft der Franzosen gab
Joseph von Görres Anfang 1814 seine
politische Zeitung der „Rheinischen Merkur“ heraus, in der er sich
aufopferungsvoll um die Befreiung des Rheinlandes bemühte und die Wiederherstellung
des Deutschen Reiches forderte. Zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands
war eine Zeitung ein wirksames Machtinstrument im öffentlichen Leben.
Ganz anders versuchte sich der
„Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn an der Wiederbelebung des deutschen Volkes. Er
sah in dem von ihm volkstümlichen Turnen nicht nur eine körperliche
Ertüchtigung, sondern ebenso eine nationale Erziehungsaufgabe. Im Jahre 1811
schuf er den ersten deutschen Turnplatz in Berlin.
IV. Die Reformen in Preußen
Die Niederlage im Krieg gegen Napoleon fügte dem Deutschen Reich schwere wirtschaftliche sowie finanzielle Verluste zu. Die besorgniserregende Situation forderte Maßnahmen, die in Form von staatlichen Reformen durchgeführt werden sollten. Die Ziele der preußischen Reformer waren unter anderem die Überzeugung von der Fähigkeit des Menschen zur Mündigkeit und Selbstbestimmung als auch dem patriotischen Wunsch nach einer inneren Erneuerung des deutschen Staates.
Die Reformen im kurzen Überblick:
Für den Staat Preußen erwiesen sich die Reformen als durchaus erfolgreich, schürten sie doch das nationale Interesse und förderten somit den Erfolg in den Freiheitskriegen. Der Bevölkerung hingegen brachten die gesellschaftlich-politischen Umgestaltungen bei weitem weniger, als dem Staate selbst. Nach der französischen Niederlage in den kommenden Befreiungskriegen, wurden die als positiv empfunden Reformen weitestgehend rückgängig gemacht und erneut eine absolutistische Regierungsform eingeleitet. Hierbei bildete sich das ländliche Proletariat aus, eine Landflucht und Armut waren die Folge.
V. Die Befreiungskriege (1813 – 1815)
Der Aufruf Friedrich Wilhelms III. „An das Volk“
Nach der Konvention von Tauroggen von 1812, einer Neutralitätszusage der preußischen Armee gegenüber Russland, organisierte der preußische Minister Stein die Stände und kündigte die herannahenden Russen als Kampfesbrüder gegenüber Frankreich und nicht als Feinde des preußischen Staates an. Preußen und Russland kämpften nun gemeinsam gegen die französischen Unterdrücker, was im Vertrag zu Kalisch 1813 vertraglich besiegelt worden war. Hiernach forderte Friedrich Wilhelm III. in seinem Aufruf „An das Volk“ am 17. März 1813 das deutsche Volk nun zur Gegenwehr gegen die Franzosen auf, um für eine nationale Einheit und verfassungsmäßige Freiheit zu kämpfen.
Der Frühjahrsfeldzug von 1813
Obwohl Napoleon die Schlacht bei Großgörschen und Bautzen im Mai 1813 gewinnen konnte, hatte er davon große Verluste tragen müssen. Seine Armee ging geschwächt aus den Kämpfen hinaus, Napoleon entschied sich deshalb für einen Waffenstillstand, erhoffte sich jedoch insgeheim, Österreich als Bundesgenossen zu gewinnen. Nach den langen Verhandlungen der Waffenruhe wollte sich Bonaparte den Forderungen Österreichs nicht beugen, da diese für ihn ein Ende der Vorherrschaft in Europa bedeutet hätten. Daraufhin schloss sich Österreich der russisch-preußischen Koalition an, der zuvor bereits schon England und Schweden beigetreten waren. Auf Frankreichs Seite standen Sachsen und die Rheinbundstaaten.
Der Herbstfeldzug von 1813
Napoleon, der über 300.000 Mann verfügte, sah sich nun drei Armeen der Koalition gegenüber, die insgesamt eine Truppenstärke von 500.000 Mann aufweisen konnten. Bonaparte, der die Elblinie mit Mittelpunkt Dresden besetzte, musste dieses letztendlich in mehreren Gefechten aufgeben und seine Truppen neu in Leipzig positionieren. Das Übergewicht der Koalitionsarmee sollte sich hierbei als entscheidender Vorteil erweisen. Durch die Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. – 19. Oktober 1813 gelang der Koalition ein wichtiger Sieg, die Franzosen wurden fast vollkommen einkreist. Deutschland war nun bis zum Rhein wieder frei, der Rheinbund löste sich auf. Da Österreich und Russland kein Interesse daran hatten, den Kampf auf französischem Boden fortzusetzen, bot man Frankreich einen Frieden an, den Napoleon jedoch ablehnte.
Der Feldzug von 1814
Am Neujahrstag 1814 drang daraufhin die Armee der Koalition in Frankreich ein und beendete seinen Feldzug mit dem Einzug in Paris (31. März 1814) und der Abdankung Napoleons (6. April 1814). Der französische Kaiser wurde anschließend auf die Insel Elba, die er als Fürstentum erhielt, verbannt. Der Bruder des hingerichteten Ludwig XVI. bestieg als Ludwig XVIII. den französischen Thron. Im ersten Pariser Frieden vom 30. Mai wurde Frankreich auf die Grenzen von 1792 reduziert. Frankreich hatte keine Kriegsentschädigungen zu bezahlen. Die Staatsmänner trafen sich zur Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress.
Der Feldzug von 1815
Napoleon konnte sich mit der neuen Lage nicht abfinden. Während auf dem Kongress in Wien über eine Neugestaltung Europas diskutiert wurde, kehrte Bonaparte nach Frankreich zurück und übernahm im März 1815 erneut die Macht in Frankreich (Herrschaft der Hundert Tage). Erneut rückte die Koalition gegen Napoleon vor und schlug ihn endgültig in der Schlacht von Waterloo am 18. Juni 1815. Der ehemalige Kaiser Frankreichs wurde auf die Insel St. Helena verbannt, wo er am 5. Mai 1821 starb.
VI. Der Wiener Kongress (1814/15)
Der Wiener Kongress
Nach mehr als 20 Jahren war der Weltkrieg beendet und der französische Kaiser Napoleon Bonaparte war endgültig besiegt. Die Armeen Preußens, Österreichs und Russlands sowie die englische Marine hatten letztendlich triumphiert und große Teile Frankreichs wurden von den Siegermächten besetzt. Das französische Volk wandte sich von seinem ehemaligen Kaiser ab, der während seiner Gefangenschaft auf der Insel St. Helena im Jahre 1821 verstarb. Mit Ende des Krieges stand Frankreich nicht nur vor einem Trümmerhaufen, auch seine wirtschaftlich führende Stellung musste es endgültig an England abtreten.
Um nun die politischen
Veränderungen, die sich nach Kriegsende ergeben hatten, rechtlich zu sichern und
zu festigen, wurde ein großer Friedenskongress in Wien angesetzt. Anfänglich
sollten nur die vier siegreichen Großmächte – Preußen, Österreich, Russland und
England – an dem so genannten
Wiener Kongress teilnehmen.
Nach einigen
Überlegungen entschloss man sich jedoch dafür, auch französische Diplomaten auf
der Zusammenkunft zuzulassen. Die Großmächte zeigten sich im Verlauf des
Kongresses keinesfalls als nachtragend gegenüber dem französischen Volk, obwohl
man mit Frankreich gedanklich eine lange Feindschaft und bittere Fremdherrschaft
verknüpfte. Die Entmachtung
Napoleons war Entschädigung genug. Auch zeigten
Österreich und Preußen kein Interesse daran, die Stellung Frankreichs in Europa
übermäßig zu schwächen, so brauchte man doch einen Staat als Gegengewicht zu
seinen Nachbarn.

Dominierender Diplomat des
Wiener Kongresses war
Klemenz Wenzel Fürst von Metternich.
Der früh in den österreichischen Staatsdienst eingetretene katholische
Rheinländer stieg zum dortigen Kanzler auf und gab mit seinen groß angelegten
Plänen dem österreichischen Staat die außen- und innenpolitischen Leitlinien.
Jeden revolutionären Experimenten, die vorwiegend von der
Französischen Revolution
ausgingen, war
Metternich von Grund auf abgeneigt und strebte zielbewusst nach
Eindämmung aller radikalen Ideen. Die liberalen und nationalen Gedanken
in einigen deutschen Kreisen waren ihm daher völlig fremd. Ziel
Metternichs war
es, schnellstmöglicht eine weitgehende
Wiederherstellung der vorrevolutionären
Verhältnisse (Restauration) zu bewirken und das Gleichgewicht der Großmächte – einschließlich
Frankreichs – wiederherzustellen. Keine Macht sollte einen Vorzug gegenüber
einer anderen erhalten, so wurde auch keinem der Vertreter des Kongresses ein
übermäßiger Einfluss zugestanden. Auch soziale Probleme waren
Metternich fremd.
Er misstraute allen Strömungen und Idealen des Bürgertums oder der akademisch
Gebildeten und unterband jegliche Form von freiheitlichen Neigungen. Diese
Unterdrückungen sollten jedoch im Laufe des 19. Jahrhunderts zu folgenschweren Konflikten führen.
Als Gegenspieler
Metternichs
auf dem Wiener Kongress war zeitweilig der preußische Minister Freiherr von
Stein zu nennen. Mit seiner Forderung nach einem zukünftigen starken Deutschland
stieß er jedoch immer wieder auf die Ablehnung und den Eigennutz der anderen Fürsten.
Hoffnung und Enttäuschungen der Nationen
In den
Befreiungskriegen hatten
die europäischen Völker hart für die Befreiung von der Herrschaft Frankreichs
kämpfen müssen. Sie taten dieses nicht für ihre Herrscher und Fürsten, sondern
für die Idee und die Hoffnung auf nationale Selbstbestimmung. Das Ziel eines
einheitlichen und unter parlamentarischer Kontrolle stehenden gesamtdeutschen
Vaterlandes, beherrschte viele revolutionäre Geister dieser Zeit. Und wer damals
als freier Mann für ein „neues Europa“ gekämpft hatte, wollte dementsprechend nun
bei der Neuordnung des inneren und äußeren Aufbaus der Staaten mitreden dürfen.
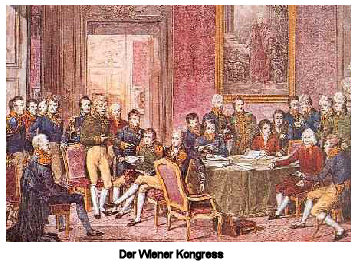 Die
Fürsten des Wiener Kongresses
vergaßen jedoch schnell die Leistungen ihrer Untertanen. Sie hatten kein
Interesse daran, ein Zeitalter eines „neuen Europas“ einzuläuten, vielmehr
sollte die weitgehende Wiederherstellung des Gewesenen –
die Restauration
– die alte Stellung der Fürsten festigen. Im Sinne der früheren Politik, wurden die Völker und
ihre Länder recht willkürlich verteilt. Eine solche Lösung war natürlich für das
deutsche Volk keineswegs zufrieden stellend. Die zukünftigen innenpolitischen
Spannungen haben hier eine ihrer Wurzeln.
Die
Fürsten des Wiener Kongresses
vergaßen jedoch schnell die Leistungen ihrer Untertanen. Sie hatten kein
Interesse daran, ein Zeitalter eines „neuen Europas“ einzuläuten, vielmehr
sollte die weitgehende Wiederherstellung des Gewesenen –
die Restauration
– die alte Stellung der Fürsten festigen. Im Sinne der früheren Politik, wurden die Völker und
ihre Länder recht willkürlich verteilt. Eine solche Lösung war natürlich für das
deutsche Volk keineswegs zufrieden stellend. Die zukünftigen innenpolitischen
Spannungen haben hier eine ihrer Wurzeln.
Auf Beschluss des
Wiener
Kongresses schlossen sich die 38 selbstständigen deutschen Staaten zum
Deutschen
Bund zusammen, der sich als sehr locker erwies und fast jede wirkliche
Bestrebung nach Einigkeit ausschaltete. Österreich und Preußen als stärkste
Mächte standen sich in diesem Bund misstrauisch gegenüber, die anderen kleineren
Staaten gruppierten sich nun entweder zur einen oder anderen Seite. Österreich
konnte in allem mehr Staaten an sich binden.
Jeder der 38 Einzelstaaten war
durch einen Vertreter im Bundestag in Frankfurt am Main vertreten, der sich
jedoch als relativ beschlussunfähig erwies. Da zu jedem Beschluss eine
Zweidrittelmehrheit – in Grundsatzfragen gar Einstimmigkeit – von Nöten war,
konnte man sich nur in den seltensten Fällen auf einen Konsens einigen. Der
Deutsche Bund wurde damit zum Symbol der gesamtdeutschen Schwäche und
Uneinigkeit. Noch deutlicher wurde diese Schwäche dadurch, dass selbst drei
ausländische Fürsten im
Deutschen Bund vertreten waren: der englische König als
König von Hannover, der dänische König als Herrscher von Holstein und der König
der Vereinigten Niederlande als Großherzog von Luxemburg. Auch das deutsche Volk
war von jedweder Mitbestimmung ausgeschlossen. Auch interne Probleme in Preußen
und Österreich, in welchen einige Provinzen erst gar nicht zum
Deutschen Bund
gehörten,
zerstörten die Hoffnung auf die herbeigesehnte Einigkeit und ein starkes
Deutschland. Aufgrund dieser Tatsachen schien es nicht verwunderlich, dass die
deutschen Patrioten sich um die Früchte ihrer Arbeit betrogen und enttäuscht fühlten.
Ihr Glaube an die Politik nah zunehmend ab.
Die Innenpolitik rückte nun
weitgehend in den Vordergrund, die
Restauration
stand im Mittelpunkt der Politik. Somit wurde das Gottesgnadentum der Herrscher
und die Vorherrschaft des Adels erneut gefestigt. Dem Volk blieben hierbei nur zwei Lösungen: Entweder
es unterwarf und begnügte sich mit seinem Privatleben. Dies führte zum
Lebensstil des Biedermeiers. Oder
man wehrte sich gegen seine Lage in einer
bewaffneten Revolution. Beide Wege wurden eingeschlagen. Die folgenden
Jahrzehnte sollten in ihrem Zeichen stehen.
VII. Das geistige Bild der Zeit
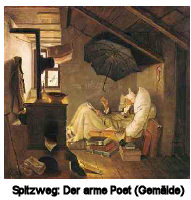
Der vergangene Krieg hatte in den Menschen Europas den Ruf nach Ruhe und Ordnung übermächtig werden lassen. Man wollte eine gemütliche Bescheidenheit im kleinbürgerlichen Rahmen. Nicht mehr wollte man sich um den Welthandel oder andere weit reichende Angelegenheiten kümmern müssen, sondern in der kleinen und überschaubaren Heimat an sein Privatleben denken. Die Architektur versuchte hierbei, die klassischen Vorbilder nachzuahmen, das Theater erlebte einen Aufschwung. Bedeutend war hierbei das Wiener Burgtheater, das die Werke Franz Grillparzers auf die Bühne brachte. Auch der Wohnstil wurde neu gestaltet, so strebte man nach behaglichen, aber dennoch einfachen und vor allem „stimmungsvollen“ Räumen mit den entsprechenden Möbeln. Tische, Stühle und Betten erhielten daher leicht geschwungene Formen. Man bevorzugte zudem helle Holzmöbel in solider handwerklicher Ausführung. Die Malerei wandte sich Geschichts- und Märchenmotiven zu, tendierte zum gemütlich stillen Betrachten und zum treffenden Humor. In der Literatur wurde der Geschichtsroman gepflegt, der die Vergangenheit idealisierte und zugleich idyllisch nahe brachte.
VIII. Reaktion und Freiheitstreben
Die Entwicklung in Deutschland
Im Deutschen Bund ragten die beiden
Großmächte Preußen und Österreich hervor, ihre wachsende Gegnerschaft machten
sich die restlichen kleineren Staaten zunutze.
In jedem Staat war das
Bestreben erkennbar, neu aufkommende Revolutionstendenzen und Aufstände sofort zu
unterdrücken und die alte Ordnung, wie vor der
Französischen Revolution bestand,
wieder einzuführen. Insbesondere in Österreich herrschte ein reges
Polizei-Regiment. Die dortige Zensur schaltete alle Äußerungen nach Freiheit in
Presse und Literatur aus. Auch in Preußen wurde zu solchen Maßnahmen
gegriffen. Die Bestrebungen nach Landreformen wurden schnell von den
Großgrundbesitzern zerschlagen, viele bäuerliche Ländereien fielen somit in
deren Hände.
Kampf um freiheitliche Gesinnung
Als Vorkämpfer für eine
freiheitliche Denkweise und als Bewahrer der Ideale der
Freiheitskriege trat die
studentische Jugend auf. Im Jahre 1815 gründeten sie die „Deutschen
Burschenschaften“, die dem Ruf nach „Einigkeit, Freiheit, Vaterland“ folgten und
sich zu den Farben Schwarz-Rot-Gold bekannten.
Zur 300. Jahresfeier der
Reformation von 1517 veranstalteten die Studenten auf der
Wartburg ein großes
Fest, auf dem die freiheitliche Gesinnung der Studenten ihren Ausdruck fand. Als
Symbole der Unterdrückung verbrannte man auf einem Scheiterhaufen den
preußischen Unteroffiziersstock, den Zopf und einige Bücher aus dieser Zeit.
Zwei Jahre später im Jahre 1819
wurde der Dichter, russische Staatsrat und Schriftsteller
Kotzebue von einem deutschen Studenten
ermordet, da sich Kotzebue gegen die nationalen Bestrebungen stellte. Dieses
Attentat hatte zur Folge, dass scharfe Beschlüsse der deutschen Regierungen auf
einer Ministerkonferenz in Karlsbad verordnet wurden.
Die Karlsbader Beschlüsse
Auf das Bestreben
Metternichs
hin, wurden die Burschenschaften und das
Turnen verboten. Zudem wurde die
Pressefreiheit aufgehoben und eine scharfe
Zensur eingeführt. Am härtesten
wurden diese Verordnungen in Preußen befolgt. Der
Turnvater Jahn wurde aufgrund
der geistigen Urheberschaft an der Tötung
Kotzebues verhaftet, Universitäten
wurden beaufsichtigt sowie jegliche Reden an das deutsche Volk überwacht oder
gar verboten.
Doch nicht nur in Deutschland,
auch im restlichen Europa wurden alle demokratischen Bemühungen unterdrückt.
Italien versuchte sich gegen die österreichischen Unterdrücker zur Wehr zu
setzen, ebenso die Griechen erhofften sich durch ihren Befreiungskampf – der in
Deutschland große Anerkennung fand – eine bessere Zukunft.
IX. Julirevolution in Frankreich
Die Julirevolution in Frankreich
Die Julirevolution in Frankreich sollte insbesondere beim deutschen Volk einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die Wiederherstellung des bourbonischen Königtums in Frankreich erzeugte neue Gegensätze zwischen Bürgertum und Adel. Anstatt diese Gegensätze zu überbrücken, war die neue Regierung unter König Karl X. darum bemüht, auch die letzten Auswirkungen der Revolution von 1789 auszumerzen und den Einfluss des Bürgertums noch weiter zurückzudrängen. Als der König Karl X. durch diktatorische Maßnahmen versuchte, das Wahlrecht zu ändern und die Pressezensur einzuführen, kam es im Juli 1830 zum bewaffneten Aufstand in Paris. Karl X. wurde vertrieben und anstatt seiner Louis Philippe zum neuen König ernannt. Der neue Herrscher wandte sich vom Gottesgnadentum ab und verstand sich als „Bürgerkönig“, der sich nicht mehr auf den Adel stütze, sondern auf das Bürgertum. Frankreich wurde mit seiner Regierungsform zum Vorbild aller bürgerlichen Fortschrittsparteien in Europa.
Entwicklung in Deutschland
Als eine der ersten deutschen
Reaktionen auf die französische
Julirevolution verjagten die Braunschweiger
ihren Herzog. Mit Sorge sahen andere deutsche Staaten diese Entwicklung und
gaben dem Volk die von ihnen gewünschten Verfassungen.
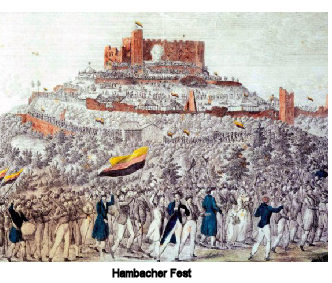 Im
Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in
Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen
Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten
mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der
Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen
Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische
Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten
Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen
Julirevolution. Im „Hambacher
Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.
Im
Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in
Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen
Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten
mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der
Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen
Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische
Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten
Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen
Julirevolution. Im „Hambacher
Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.
Auch
gegen den Frankfurter Bundestag kam es im April 1833 im „Frankfurter
Wachensturm“ zu einem Studentenputsch. Der politische Wille des deutschen Volkes
war unverkennbar.
Doch die Regierungen verstanden
und sahen das politische Aufbegehren ihrer Völker nicht. Anstatt einen Schritt
zum Volk zu machen, entschieden sich die Fürsten, die
Zensur noch strenger zu
handhaben und ordneten durch eine neu erschaffene Untersuchungskommission
Hunderte von Verhaftungen an. Allein schon das Zeigen einer schwarz-rot-goldenen
Fahne wurde geahndet. Bedeutsames Zeugnis der freien Meinungsäußerung war der
Protest der „Göttinger Sieben“, unter ihnen die
Gebrüder Grimm, die gegen die
Aufhebung der hannoverschen Verfassung protestierten. Es endete damit, dass alle
sieben Professoren aus dem akademischen Dienst entlassen wurden. Das deutsche
Volk zeigte Mitgefühl mit den Professoren und sammelte Geld, um ihnen ihr Gehalt
weiterhin zu bezahlen. Obwohl die Entlassung die gegenteilig erhoffte
Wirkung des hannoverschen Fürsten mit sich zog, ging die „Demagogenverfolgung“
weiter.
X. Der
Liberalismus
Aufstieg des Bürgertums
Durch die Einführung der Maschine, den Aufschwung der Wirtschaft und die besseren Verkehrsverhältnisse, begannen unter anderem auch die deutschen Städte aufzublühen. Eng verbunden war hiermit der Aufstieg des Bürgertums. Durch den Wegfall der Zunftschranken und die Einführung der Gewerbefreiheit hatte nun der Tüchtige die Möglichkeit, sich durch eigene Arbeit zu Wohlstand zu verhelfen. Allmählich wurden die aus früheren Zeiten stammenden Beschränkungen des Bürgertums (z. B. Berufsbeschränkungen) zunehmend abgelehnt. Das Volk wollte sich nicht mehr von der Obrigkeit bevormunden lassen.
Wesen und Ziele des Liberalismus
Die Anhänger dieser
Betrachtungsweise nannten sich
Liberale. Diese verlangten die bürgerlichen
Grundfreiheiten, die sich aus den Menschenrechten erklärten sowie eine
konstitutionelle Regierung unter Teilnahme einer Volksvertretung. Wirtschaftlich
vertrat man das freie Unternehmertum, das Privateigentum und den Freihandel ohne
Zölle. Außenpolitisch forderten die
Liberalen Freiheit und Selbstbestimmung für
alle Völker und bemühten sich um den deutsch-nationalen Einheitsstaat.
Doch obwohl es in Deutschland
niemals zu einer Herrschaft des
liberalen Bürgertums
kam, waren die
liberalen Strömungen keineswegs
zu unterschätzen.
XI. Die Wirtschaft – Wegbereiterin der deutschen Einheit
Die Anfänge der Industrialisierung in Deutschland
Die
industrielle Entfaltung
Deutschlands wurzelte indirekt in der
Kontinentalsperre
Napoleons. Als von England
weder Eisen noch Kohle nach Deutschland
geliefert werden konnten, entwickelte sich im Ruhrgebiet allmählich eine
Schwerindustrie. Auch die Tuch- und Leinenindustrie erhielt neuen Auftrieb. In
der Landwirtschaft wurde der überseeische Rohrzucker durch die deutsche
Zuckerrübe ersetzt. Der Verzicht der Dreifelderwirtschaft erhöhte entscheidend
die Ernteerträge. Die Entwicklung von großen Fabriken wurde jedoch aufgrund der
Kleinstaaterei und Mangel an Kapital maßgebend erschwert.
Das Ende der
Kontinentalsperre
1815 führte zu einem Rücklauf der deutschen vorindustriellen Bestrebungen.
Englische Fabrikwaren überschwemmten wieder den deutschen Markt. Die hohe
Schuldenlast aus den Napoleonischen Kriegen und der Besatzungszeit konnte nur
langsam wieder abgebaut werden. Um die Zeit von 1815 kamen zudem noch einige
Missernten dazu, die eine Vergrößerung der bürgerlichen Armut nur noch
vergrößerten. Erst in den 1830er Jahren konnten viele Schwierigkeiten auf
diesem Gebiet überwunden werden. Eine neue Generation von Unternehmern wuchs
heran, so zum Beispiel Alfred Krupp, der eine Eisenverarbeitungsfabrik in Essen
gründete, die später viele tausende Arbeiter beschäftigte.
Der Deutsche Zollverein
Im Laufe der Zeit wuchsen die einzelnen deutschen Staaten immer weiter zusammen. Bereits seit der Erwerbung des Rheinlands und Westfalens drängte Preußen immer mehr auf eine Beseitigung der Durchgangszölle, die den Handel innerhalb Deutschlands erschwerten. Die hohe Anzahl an Zollschranken, die hohen Verwaltungskosten und der wachsende Schmuggel wurden immer hinderlicher. Der Gedanke eines gesamtdeutschen Zollvereins, der zu einem wirtschaftlich geeinten Deutschland beitragen sollte, wurde wach. Im Jahre 1834 wurde daraufhin der „Deutsche Zollverein“ gegründet, dem alle deutschen Staaten – mit Ausnahme Österreichs – angehörten. Er umfasste ein Gebiet von 420.000 km2 mit etwas 23,5 Millionen Einwohnern.
Die ersten deutschen Eisenbahnen
Westfälische Industrielle förderten den Bau einer Eisenbahn zwischen Köln und Minden, planten ebenso eine Kanalverbindung zwischen Rhein und Weser, um der Hansestadt Bremen Vorteile in Falle der Industrieerzeugnisse zu bringen. Bayrische Geldgeber ermöglichten den Bau der ersten deutschen Eisenbahn 1835 von Nürnberg nach Fürth. In der Zeit zwischen 1840 und 1850 verzwölffachte sich die Anzahl der Streckennetze.
XII. Deutsches Geistesleben
In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts konnte sich das deutsche Volk im politischen Bereich nicht
sonderlich durchsetzen. Auf dem Gebiet des Geistigen konnte man sich jedoch bei
weitem mit allen Völkern der Erde messen. Die französische Schriftstellerin
Madame de Staël hatte Deutschland um 1800 gar als „Land der Dichter und Denker“
bezeichnet. Während Goethe mit „Faust II“ sein einzigartiges Lebenswerk
abschloss, führte Beethoven in seinen späten Werken die abendländische Musik zu
einer neuen Höhe. Ebenso in der Philosophie tat sich Deutschland hervor. Der
Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel
schuf sein maßgebendes System der
Philosophie, das auch noch heute von nicht geringer Bedeutung ist. Seine
Deutungen der Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, des
Staates als verwirklichte sittliche Idee, waren für Europa von entscheidender
Bedeutung.
Zeitgleich machte sich seit den
1830er Jahren eine Bewegung des „Jungen Deutschland“ einen Namen, die mit
scharfer Kritik die politischen und sozialen Verhältnisse monierte.
Heinrich
Heine, Ludwig Börne und
Ferdinand Freiligrath wurden rasch volkstümlich. Ebenso
bedeutend war Georg Büchner, der mit seinen Dramen „Dantons Tod“ und „Woyzeck“
erst nach seinem Tod volle Anerkennung erlangte. Zu bemerken ist, dass alle
diese Personen ins Ausland fliehen mussten. Das reaktionäre Deutschland des
Biedermeiers war für diese kritischen und freien Geister nicht gedacht.
XIII. Deutschland vor der Revolution
Friedrich Wilhelm IV.
(1840 – 1861)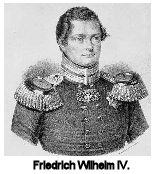
Im Jahre 1840 wurde Friedrich Wilhelm IV. zum König von Preußen ernannt. Mit dem Sohn Friedrich Wilhelms III. versprach man sich den Beginn einer freiheitlichen Ära, Einschränkung der Polizeigewalt und Verstärkung der Volksrechte in einer modernen Verfassung. Doch obwohl sich der neue preußische König als durchaus großzügig erwies und unter anderem zahlreiche politische Verfolgte begnadigte (so zum Beispiel die Gebrüder Grimm), änderte dieses nichts an dessen Einstellung. Denn gerade Friedrich Wilhelm IV. betonte sein Gottesgnadentum und stand damit im scharfen Gegensatz zu den beiden geistlich-politischen Hauptströmungen der damaligen Zeit: der Demokratie und dem Liberalismus.
Der Wechsel von einer agrar- zu
einer kapitalistischen Industriegesellschaft mit dem gleichzeitig
explosionsartigen Zuwachs der Bevölkerung, sorgte für Probleme wirtschaftlicher
und sozialer Natur, denen die Regierungen lange Zeit nicht Herr werden konnten.
Auch die Erhöhung der Nahrungsmittelerzeugung, die bedeutenden technischen
Fortschritte sowie die Ausweitung der gewerblichen Produktion konnten den
Problemen nicht entgegenwirken. Die Wirtschaftskraft reichte in den meisten
Ländern einfach nicht aus, um Hunger, Not und Arbeitsmangel entgegenzuarbeiten.
Die Zeit der Frühindustrialisierung (1820 – 1850) wurde somit zu einem Zeitalter
der Massenarmut, des „Pauperismus“.
Schon in den Jahren 1816/17 führten Missernten zu Hungersnöten. In der Zeit
1846/47 verschärfte sich die Situation sogar noch, als eine Million Menschen den
Hungertod starben. Ebenso sorgte eine Cholera-Epidemie in den 1830er Jahren, der
insbesondere durch Unterernährung geschwächte Menschen zum Opfer fielen, für
eine wesentliche Verschlechterung der Lebenssituation der Bevölkerung.
Die zahlreichen Protestaktionen
dieser Zeit entstanden durchweg aufgrund solcher Notsituationen. Bauern
rebellierten unter anderem gegen die Nutzungsrechte am ehemaligen Gemeinbesitz,
die Handwerker forderten ein gerechtes Preis-Einkommens-Verhältnis und Arbeiter
protestierten gegen zu geringe Löhne und zu lange Arbeitszeiten.
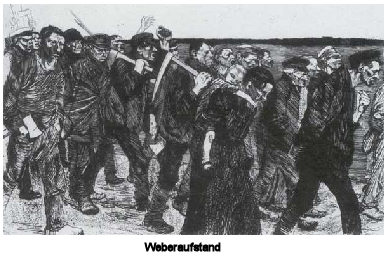 Die
Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im
schlesischen Weberaufstand. Als Handarbeiter waren die Leinenweber nicht in der
Lage, mit der Produktivität der modernen maschinellen Webstühle mitzuhalten. Sie mussten trotz längerer Arbeitsdauer immer niedrige Verkaufszahlen in Kauf
nehmen. Die Demonstrationen wurden vom preußischen Heer schnell
unterdrückt.
Die
Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im
schlesischen Weberaufstand. Als Handarbeiter waren die Leinenweber nicht in der
Lage, mit der Produktivität der modernen maschinellen Webstühle mitzuhalten. Sie mussten trotz längerer Arbeitsdauer immer niedrige Verkaufszahlen in Kauf
nehmen. Die Demonstrationen wurden vom preußischen Heer schnell
unterdrückt.
Doch nicht nur in Schlesien kam
es zu Unruhen, auch in anderen preußischen Provinzen war der Unmut der
Bevölkerung zu spüren. Der Ruf nach einem „Vereinigten Landtag“ wurde laut, der
die politische Mitbestimmung für alle preußischen Gebiete garantieren sollte.
Hatten bisher nur acht Provinzen die Möglichkeit, sich ins politische Leben des
Staates einzufügen, sollten mit dem „Vereinigten Landtag“ Vertreter ganz
Preußens zusammenkommen.
Friedrich Wilhelm IV. zeigte jedoch wenig Interesse,
diese Einrichtung als eine dauerhafte Institution Preußens zu etablieren. Immer
wieder betonte er sein Gottesgnadentum und wandte sich gegen eine freiheitliche
Verfassung.
Das Streben nach einer demokratisch-freiheitlichen Verfassung
Während in Länder wie den Vereinigten Staaten von Amerika oder den westeuropäischen Ländern das Bürgertum an die Macht gelangt war, waren Preußen und Österreich in dieser Hinsicht immer noch als rückständig zu bezeichnen. Noch immer herrschten dort absolutistische Regierungsformen vor. Diese Verzögerung gegenüber dem Westen fand zum einen seine Ursache in der Zersplitterung Deutschlands in viele kleinere Einzelstaaten sowie in der Vernichtung des städtischen Frühkapitalismus. Der Krieg gegen Napoleon, die wirtschaftliche Vereinigung durch den Deutschen Zollverein sowie das Aufkommen des Liberalismus schürten im Volk jedoch immer mehr den Wunsch nach einer modernen demokratisch-freiheitlichen Verfassung.
Die deutsche Märzrevolution von 1848
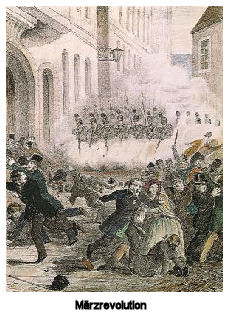 In
Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes
Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen
Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres
Barrikadenkämpfe aus. Diese Taten sorgten für Aufsehen im deutschen Volk, das
nun umso heftiger sein Recht auf Presse- und Redefreiheit und eine Einführung
der Volksbewaffnung verlangte. Ausgehend von Baden, der Rheinpfalz und
Westfalen, erfasste diese große Volksbewegung bald weite Teile Deutschlands.
Überall gaben die Regierungen kampflos auf und beugten sich dem Willen des
Volkes.
In
Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes
Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen
Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres
Barrikadenkämpfe aus. Diese Taten sorgten für Aufsehen im deutschen Volk, das
nun umso heftiger sein Recht auf Presse- und Redefreiheit und eine Einführung
der Volksbewaffnung verlangte. Ausgehend von Baden, der Rheinpfalz und
Westfalen, erfasste diese große Volksbewegung bald weite Teile Deutschlands.
Überall gaben die Regierungen kampflos auf und beugten sich dem Willen des
Volkes.
Ihren Höhepunkt fanden die
deutschen Märzevolutionen von 1848 in Berlin, wo sich eine große Menschenmenge
vor dem Berliner Schloss versammelte, um den Monarchen ihre Forderungen zu
übermitteln. Die gewaltbereite Menge zeigte sich erfreut, als der König den
Volkswünschen weitgehend entgegenkam. Während der Verhandlungen kam es jedoch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Wachleuten,
zwei Schüsse fielen. Die Menge floh, aber nun wuchsen überall Barrikaden:
Pflaster wurden aufgerissen, Wagen umgeworfen. Das Volk griff zu den Waffen, es
folgten blutige Kämpfe in den Straßen Berlins.
Noch in derselben Nacht
entschloss sich der König, dem Treiben ein Ende zu setzen und willigte
vorbehaltlos in die Forderungen der kämpfenden Menge ein. Die Revolution hatte
gesiegt. Als Symbol der Anerkennung der Gefallenen zwang das Volk seinen
Monarchen durch Abnehmen seiner Mütze die Opfer der Barrikadenkämpfe zu ehren.
Dies stellte eine außergewöhnliche Tat in der Geschichte der preußischen
Monarchie dar. Der König musste sofort ein
liberales Kabinett einberufen und
verkündete von fortan, dass Preußen in einem fortschrittlichen und modernen
Deutschland aufgehen solle.
In der alten Reichsstadt
Frankfurt am Main trat die erste
deutsche Nationalversammlung in der
Paulskirche
zusammen, das erste gesamtdeutsche, frei gewählte und verfassungsgebende
Parlament. Dort versammelte sich eine geistige Auslese Deutschlands, die sich
vorwiegend aus Akademikern zusammensetzte. Personen wie
Jakob Grimm,
Ernst
Moritz Arndt, der
Turnvater Jahn,
Ludwig Uhland,
Brentano und
Fröbel
verschafften der Nationalversammlung auch über die Grenzen Deutschlands
Anerkennung. Zum Präsidenten wurde Heinrich von Gagern gewählt. 
Es dauerte jedoch nicht lange,
bis nach einiger Zeit die Vertreter des gebildeten Bürgertums von den
Forderungen der Radikalen abrückten. Zunehmend zeichnete sich eine
Parteienbildung ab, nachdem sich weite Kreise des Bürgertums den radikalen
Revolutionsforderungen entgegenstellten. Die wochenlangen Barrikadenschlachten
1830 in Paris waren für viele Abgeordnete jedoch ein warnendes Beispiel. So
wählten sie als Reichsverweser, d. h.
als Oberhaupt der provisorischen
Reichsregierung, den Erzherzog Johann. Da sich Preußen und Österreich gegen die
Forderung stellten, ihre Truppen auf den neuen
Reichsverweser zu vereidigen, war
die Nationalversammlung ohne eigenes Militär. Auch gewann sie keine
Verwaltungskompetenz gegenüber den Einzelstaaten. Ebenso die stetig
voranschreitende Aufspaltung der Abgeordneten in politische Zusammenschlüsse
führte dazu, dass man weitgehend machtlos blieb.
Die
Frankfurter
Nationalversammlung setzte im Dezember 1848 den ersten Grundrechtskatalog der
Deutschen auf. Nach langen Diskussionen schufen die Abgeordneten eine
Verfassung, die noch bis zum Bonner Grundgesetz von 1949 Einfluss haben sollte.
Dann geriet die Versammlung jedoch in Konflikt, als es zum Thema der nationalen
Einheitsbewegung kam. Ohne Zweifel bestand diese Bewegung bereits, jedoch
spaltete sie sich in eine
kleindeutsche
und großdeutsche
Lösung auf. Die
Kleindeutschen forderten die deutsche Reichseinheit unter der Herrschaft
Preußens und Ausschluss Österreichs, wohingegen die
Großdeutschen auch die
Deutschen der Donaumonarchie mit einbinden wollten.
Am 28. März 1849 wurde die
Reichsverfassung angenommen und
Friedrich Wilhelm IV. zum deutschen Kaiser
gewählt. Dieser sprach sich jedoch voller Verachtung gegen das feierliche
Angebot aus und lehnte die Kaiserkrone ab:
„Einen solchen imaginären Reif, aus Dreck und Letten gebacken, soll ein legitimer König von Gottes Gnaden und nun gar der König von Preußen sich geben lassen, der den Segen hat, wenn auch nicht die älteste, doch die edelste Krone, die Niemand gestohlen worden ist, zu tragen? ... Ich sage es Ihnen rund heraus: Soll die tausendjährige Krone deutscher Nation, die 42 Jahre geruht hat, wieder einmal vergeben werden, so bin ich es und meines Gleichen, die sie vergeben werden. Und wehe dem, der sich anmaßt, was ihm nicht zukommt!“
Damit war das Hauptanliegen der Frankfurter Nationalversammlung, die Gründung eines deutschen Einheitsstaates, gescheitert.
Der Sieg der Reaktion
Mittlerweile hatte sich der
Gegensatz zwischen dem auf der einen Seite gebildeten Bürgertum und den auf der
anderen Seite Arbeitern sowie von der aufkommenden Industrie bedrohten kleinern
Handwerkern immer weiter vertieft. Unter der Führung von Friedrich Hecker
versuchte das revolutionäre Volk, die Regierungsgewalt in Baden an sich zu
reißen. Die Widerstandsbewegung wurde aber von den Bundestruppen gewaltsam
niedergeschlagen. Ebenso wurden völkisch-revolutionäre Bewegungen in Ungarn sowie in Berlin und Dresden blutig vom staatlichen Militär
gestoppt. Obwohl in Österreich die revolutionären Mächte anfangs auch siegreich
waren und ihren Staatskanzler
Metternich als Symbol der
Reaktion stürzten, wurden
auch hier die bewaffneten Aufstände gewaltsam niedergeworfen. Die
Reaktion hatte
allerorts gesiegt.
XV.
Deutschland nach der Revolution
Auflösung der Nationalversammlung
In Frankfurt am Main wurden die Abgeordneten der Nationalversammlung durch Soldaten daran gehindert, der Sitzung der Paulskirche beizuwohnen. In Berlin zog wieder der König mit seinen Soldaten ein, die Bürgerwehr der Aufständischen wurde aufgelöst. Die Kämpfer für ein einheitlich-freies Deutschland wurden überall verfolgt und eingesperrt, manche erschossen.
Die oktroyierte Verfassung
Nach dem Sieg der
Reaktion wurde
auch bald in Berlin ein konservatives Ministerium ernannt und somit eine
Militärdiktatur errichtet. Die preußische Nationalversammlung musste auseinander
treten, schließlich wurde das Wahlrecht geändert. Der König erließ eine
oktroyierte (von oben erlassene) Verfassung, d. h. sie wurde ohne Einwirkung des
Volkes beschlossen. Diese Verfassung von 1850 – die in Preußen bis 1918 galt – führte erstmals das Dreiklassenwahlrecht ein. Somit wurde die
Stimmenzahl nach der Steuerleistung bewertet. Die vollziehende Staatsgewalt
blieb alleinig in den Händen des Königs.
Der Versuch, die Gründung eines
einheitlichen und freiheitlichen Deutschland zu erreichen, erfolgte erst 21
Jahre später mit der
Reichsgründung 1871.
Jahre später als in England
entwickelten sich in Deutschland die Industrie und der moderne Kapitalismus. Die
soziale Frage im Lande wurde aus diesem Grund auch erst später aktuell und
zeigte sich bei weitem nicht so bedrohlich, wie es in Großbritannien der Fall
gewesen war. Dennoch entwickelte sich in Deutschland besonders in den Regionen
mit einem hohen Vorkommen an Heimarbeit größte Not durch die Auswirkungen der
industriellen Revolution. Deshalb waren es zuerst die Weber in die 1840er
Jahren, die durch
Aufstände gegen ihre bedenkliche Lage protestierten.
Zur Zeit der Revolution in
Deutschland 1848 war die abhängige, wirtschaftlich besitzlose Arbeiterklasse
zunächst noch unorganisiert und trat wenig selbstbewusst auf. Erst der rasche
Aufstieg der deutschen Wirtschaft in den 1850er und 1860er Jahren führte zu
wachsenden Bewegung des Proletariats. Besonders in der Kohlen- und
Eisenindustrie stand eine kleine Gruppe von Unternehmern einer großen Masse
besitzloser Handarbeiter gegenüber.
Es bestand ein Überangebot an
Arbeitskräften, was zu niedrigeren Löhnen führte. Um den Lebensunterhalt zu
sichern, waren nun mehrere Familienmitglieder gezwungen, arbeiten zu gehen, dies
führte zu weiteren Lohnminderungen. Auch die Arbeitshygiene und Sicherheit der
Arbeiter ließen noch viel zu wünschen übrig. Ein Arbeitstag von 15 Stunden war
keine Seltenheit, auch Sonntags- oder Nachtarbeit
bildeten keine Ausnahme mehr. Am schärfsten trafen die Wirtschaftskrisen das
ohnehin schon geplagte Proletariat.
Solche Arbeitsbedingungen
führten in der Bevölkerung schnell zur Massenarmut. Teilweise besaß eine Familie
nur ein Zimmer für sich, die Lebenserwartung sank und ein Bildungsmangel des
deutschen Proletariats war nicht mehr zu verhindern. 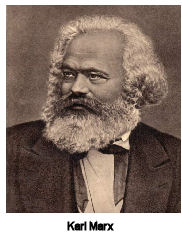
Insbesondere
Karl Marx war bei
der Behandlung der sozialen Frage große Bedeutung zuzusprechen. Er schuf eine
neue Art des volkswirtschaftlichen und politisch-gesellschaftlichen Denkens und
formte die Wertevorstellung vieler Menschen. Hiermit blieb
Marx einer der
großen revolutionären Denker im politischen-sozial Leben des 19. Jahrhunderts.
Um gegen diese eklatanten
Zustände vorzugehen, wurden 1839 die ersten Fabrikgesetze in Preußen erlassen.
Zudem versuchte die christliche Sozialbewegung die Arbeiterschaft zu
unterstützen. Die Gründung des
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 1863, der
Internationalen Arbeiterassoziation (1864 von Karl Marx ins Leben gerufen) und
der Gewerkschaften in den 1860er Jahren waren weitere Versuche, um der
wachsenden beunruhigenden Lage entgegenzuwirken. In seinem Werk "Das Kapital"
kritisierte Marx die Wirtschaftsverhältnisse seiner Zeit und versuchte ein Entwicklungsgesetz der Gesellschaft aus den Notwendigkeiten der Wirtschaft
für die Zukunft zu geben.
Die sozial-wirtschaftlichen
Probleme wurden in naher Zukunft ohne weiteres nicht gelöst, auch wenn
die sozialen Maßnahmen durchaus Erfolge zeigten.
XVII. Die Reichsgründung
Otto von Bismarck
In Preußen war am 23. September
1862 Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt worden, um
einen aufgekommenen Verfassungskonflikt im Sinne des Königs Wilhelm I. zu lösen.
Unter Ausschaltung des Landtags führte
Bismarck nach seiner Ernennung die
Heeresreform durch, die den Konflikt beseitigte. Somit war
Bismarck zwar an der
Macht, regierte jedoch verfassungswidrig und ohne genehmigten Etat. Durch
außenpolitische Erfolge versuche er, von der innenpolitischen unvorteilhaften
Situation abzulenken. 
Die Kampf zwischen Preußen und Österreich um die Vorherrschaft in Mitteleuropa
Die ohnehin schon vorhandenen Gegensätze zwischen Österreich und Preußen verschärften sich zunehmend nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864, den die Staaten des Deutschen Bundes für sich entscheiden konnten. Preußen wollte den wichtigen Hafen Kiel zum Kriegshafen umbauen und die neu gewonnenen Herzogtümer Schleswig und Holstein wirtschaftlich enger an sich binden. Österreich fühlte sich durch diese Forderungen benachteiligt und sprach sich gegen die preußischen Vorstellungen aus. Obwohl diese Abmachungen letztendlich doch im Vertrag zu Gastein 1865 von beiden Seiten unterzeichnet wurden, bedeutete dies nicht das Ende der preußisch-österreichischen Gegensätze. Als Bismarck eine Reform des Deutschen Bundes verlangte und ein allgemeines und gleiches Wahlrecht forderte, trat Österreich dazu offen entgegen. Die Donaumonarchie befahl die Mobilmachung gegen Preußen. Dieser Schritt wurde mit dem preußischen Austritt aus dem Deutschen Bund beantwortet.
Preußisch-Österreichischer Krieg (1866)
Bismarck wollte mit allen
Mitteln die deutsche Frage lösen und Preußen letztendlich die Vorherrschaft in
Deutschland zu
ermöglichen. Die Mehrheit der deutschen Staaten stand auf der Seite Österreichs.
Preußens Aufforderung, die österreichische Mobilmachung sofort einzustellen,
lehnten Hannover, Sachsen und Hessen-Kassel ab. Darauf
besetzte Preußen diese
Länder ohne Kriegserklärung.
Am 3. Juli 1866 kam es zur
entscheidenden Schlacht zwischen Preußen und Österreich auf dem Schlachtfeld von
Königgrätz. Österreich wurde hierbei besiegt und der Feldzug damit beendet.
Der Sieg war für den Staat
Preußen mehr als bedeutsam, bedeutete es für ihn die Vormacht in Mitteleuropa.
Hannover und Kurhessen, Schleswig-Holstein sowie Frankfurt am Main wurden von
Preußen annektiert. Das Land nahm somit um ¼ seiner Größe und Einwohnerzahl zu.
Die Gründung des Norddeutschen Bundes
Mit dem Sieg über Österreich war nun der Weg zu einer Gründung des Norddeutschen Bundes frei. Bismarck ließ ein Bundesparlament aus allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen hervorgehen und verwirklichte somit die Idee der alten 1848er. Der Einfluss des Parlaments auf die Regierung wurde jedoch durch die Einführung des Bundesrates geschmälert, in dem sich fortan die Vertreter der einzelnen Staaten trafen.
Der Deutsch-Französische Krieg (1870/71)
Einer der Hauptursachen des
Deutsch-Französischen Krieges ist im Streit um die Besetzung des spanischen
Throns zu finden. Nach dem Sturz von Isabelle II. 1868 entschieden sich die
spanischen Regierungsvertreter, einen Prinzen aus dem Hause der Hohenzollern den
frei gewordenen Thron anzubieten. Trotz des heftigen Widerstands des preußischen
Königs, sagte der deutsche Prinz nach Drängen
Bismarcks zu. Frankreich hingegen
sprach sich scharf gegen diese Besetzung aus, da es sich auf die Weise von
Preußen und einem
mit diesem verbündeten Spanien eingeschlossen fühlte. Nach einer versteckten
Kriegsdrohung der Franzosen verzichtete Prinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen freiwillig auf die Krone. Frankreich drängte im
Anschluss darauf, der preußische König solle als Oberhaupt der Hohenzollern
auch zukünftig allen Mitgliedern seines Hauses den spanischen Thron untersagen.
König Wilhelm I. lehnte diese Forderung ab und teilte den Inhalt seines
Gesprächs mit dem französischen Gesandten in Bad Ems
Bismarck in einer Depesche
mit. Dieser veröffentlichte die „Emser Depesche“ daraufhin in zugespitzter
verkürzter Form. Frankreich fühlte sich aufgrund dessen in seiner Ehre verletzt
und erklärte Preußen im Juli 1870 den Krieg.
Ganz Deutschland griff zu den
Waffen. Frankreich wurde nach einer Reihe blutiger Kämpfe letztendlich
besiegt und sein Kaiser Napoleon III. in Sedan 1870 gefangen genommen. Darauf
rief das französische Volk die Republik aus, der Krieg wurde fortgesetzt. Doch
auch das letzte Aufbäumen gegen die preußische Armee misslang und fand im
Frieden von Frankfurt am Main im Mai 1871 sein endgültiges Ende. Frankreich
musste das Gebiet Elsaß sowie Teile Lothringen an Preußen abtreten und
verpflichtete sich zur Zahlung einer Kriegsentschädigung von fünf Milliarden
Goldfranc.
Die Reichsgründung
 Währendessen
bereitete Bismarck die endgültige Gründung des
Deutschen Reiches vor. Nachdem
Bayern und Württemberg Sonderrechte zugestanden wurden, hatte man alle deutschen
Fürsten zur Bildung eines einheitlichen
Deutschen Reiches
gewinnen können. Im französischen Königsschloss in Versailles wurde am 18.
Januar 1871 der preußische
König
Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser ernannt. Als Reichskanzler
wurde Bismarck bestimmt.
Währendessen
bereitete Bismarck die endgültige Gründung des
Deutschen Reiches vor. Nachdem
Bayern und Württemberg Sonderrechte zugestanden wurden, hatte man alle deutschen
Fürsten zur Bildung eines einheitlichen
Deutschen Reiches
gewinnen können. Im französischen Königsschloss in Versailles wurde am 18.
Januar 1871 der preußische
König
Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser ernannt. Als Reichskanzler
wurde Bismarck bestimmt.
Eine Schwäche der Reichsgründung
war jedoch, dass der Staat in erster Linie von den Fürsten, der Armee und von
den Beamten, also weniger durch das Volk geführt wurde und somit von Anfang an
ein Obrigkeitsstaat war. Der Ausbruch schwerer innerer Konflikte findet unter
anderem hierin seine Ursachen.
Bezeichnenderweise waren fast
nur Fürsten und Vertreter der siegreichen deutschen Armee bei dieser
Kaiserproklamation anwesend.
Die Reichverfassung von 1871
Das
Deutsche Reich bestand nun
aus 25 Bundesstaaten, zu denen noch das „Reichsland Elsass-Lothringen“ hinzukam.
Die Reichflagge trug die Farben Schwarz-Weiß-Rot und wandte sich damit bewusst
vom Schwarz-Rot-Gold der Frankfurter Paulskirche von 1848 ab.
Die
Verfassung versuchte, eine
starke Monarchie beizubehalten, in der der Kaiser den Reichskanzler berief und
den Oberbefehl über Heer und Flotte besaß. Nur er alleine verfügte über die
Entscheidung über Krieg und Frieden. Unter dem Kaiser standen die übrigen
deutschen Fürsten. Als eigentlicher Träger der Reichsgewalt wurde der Bundesrat
ins Leben gerufen, in dem jeder Bundesstaat vertreten war. Das Gegengewicht dazu
bildete der Reichstag, der aus allgemeinen, gleichen und geheimen völkischen Wahlen
hervorging.
Die wirtschaftliche Entwicklung nach 1871 in Deutschland
Die Gründung des Deutschen Reiches und der Sieg über Frankreich 1871 gaben der deutschen Wirtschaft einen mächtigen Auftrieb. Die Zolleinheit des vereinten Deutschlands brachte der Industrie gute Absatzmöglichkeiten, viele handwerkliche Betriebe entwickelten sich zu Fabriken. Immer mehr bildete sich das Bedürfnis zum Großbetrieb aus. Während andere europäische Staaten an der Schwerindustrie festhielten, wuchsen in Deutschland mächtige Eisen-, Stahl-, Kohle- und Chemiekonzerne heran. Deutschland stellte mittlerweile das mächtigste Land im Maschinenbau dar.
Die Landflucht und Schutzzollpolitik
Durch das rasche Anwachsen der
deutschen Industrie, stieg auch die Einwohnerzahl der Städte im schnellen Tempo.
Besonders groß war die Abwanderung aus den ostdeutschen Agrargebieten nach
Berlin, Mitteldeutschland und in das Ruhrgebiet.
Die städtische Bevölkerung hatte
angesichts der niedrigen Löhne den Wunsch, Lebensmittel möglichst billig
einzukaufen. Nach der Erschließung der großen Gebiete in Übersee und der
Möglichkeit, Nahrungsmittel günstig nach Europa zu verschiffen, ergab sich bald
ein empfindlicher Wettbewerb auf dem deutschen Markt. Durch Einsatz moderner
Maschinen und durch billigere Arbeitskräfte konnten andere Länder ihre
Agrarprodukte weitaus günstiger anbieten, als die deutschen Betriebe. Auch die deutsche Industrie musste unter dem ausländischen Wettbewerb
leiden.
Um einer
wirtschaftlichen Gefahr
zu entgehen, verlangten Großgrundbesitzer und Fabrikunternehmer einen
Schutzzoll
auf ausländische Waren und Lebensmittel, um einheimische Produkte leichter
verkaufen zu können.
XVIII. Deutschlands innere Lage nach 1871
Der Kulturkampf
Schon in der
Frankfurter
Nationalversammlung hatten sich katholische Abgeordnete zusammengefunden,
die sich
selbst später „Zentrum“ nannten. Sie traten eindringlich für den Schutz der
katholischen Einrichtungen ein und betonten den konfessionellen Charakter der
Schule. Als im Juli 1870 das vatikanische Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes
bei Grundsatzentscheidungen über Fragen des Glaubens und der Sitte aussprach,
kam es zu einer Spaltung der deutschen Katholiken. Als
Bismarck sich weigerte,
Maßnahmen gegen die gespalteten Katholiken zu ergreifen, kam es zum offenen
Konflikt mit dem Vatikan. Nach der Annexion des Kirchenstaates durch Italien
forderte die Zentrumspartei den Reichskanzler auf, zu der Wiedererrichtung des
Vatikans beizutragen.
Bismarck lehnte auch diese Forderung ab und betonte den
Vorrang des Staates vor allen anderen Einrichtungen. Daraufhin kam es zu
schweren Auseinandersetzungen. Da
Bismarck den übernationalen Anspruch der
katholischen Kirche aus Gründen der Reichssicherung nicht anerkennen wollte,
ließ er den Jesuitenorden verbieten, überwachte kirchliche Reden und
ordnete die Schließung aller katholischen Schulen zugunsten von Staatsschulen
an. Die sich aufgrund dessen entwickelten Protestbewegungen beantwortete der
Reichskanzler mit der Verhaftung zahlreicher führender Persönlichkeiten. Die
Katholiken beugten sich jedoch nicht und gingen nur noch umso entschlossener in
den deutschen Kulturkampf. Die preußische Regierung erließ die „Maigesetze“ von
1873, um den katholischen Widerstand zu brechen.
Nach fast zehn Jahren
Kulturkampf musste
Bismarck einsehen, dass eine gewaltsame Lösung die erstrebte
Einheit nicht herbeiführen konnte. Im Gegenteil, die protestantischen und
katholischen Deutschen hatten sich im Laufe der Zeit immer weiter entfremdet.
Die Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung
Die hohen Kosten für essentielle
Güter in der Zeit der Schutzzollpolitik belastete gerade die deutsche
Arbeiterschaft. Eine Erhöhung der Löhne war jedoch aus dem Grund der
Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ausland nicht denkbar. Verdienten weite Teile des
Bürgertums und vor allem die Industrieunternehmer gut, so wurde die Lage der
Massen immer erdrückender. Diese nahmen auch nur im geringen Maß am allgemeinen
wirtschaftlichen Aufschwung teil. Hinzu kamen die wenig erfreulichen
Wohnbedingungen in den großen Städten. Zuvor auf dem Land hatten die Menschen
geräumig und zudem billig gewohnt, nun mussten sie für die neu angelegten
Mietskasernen in der Stadt hohe Mieten entrichten. Die möglichst billig gebauten
Gebäude boten nur wenig Lebensqualität, an eine ausreichende Hygiene war nicht zu
denken. Die Sozialdemokraten wuchsen rasch zu einer Partei der Arbeiterschaft
auf, die sich für bessere Lebensverhältnisse einsetzte.
Nachdem auf
Kaiser Wilhelm I.
zwei Attentate verübt wurden, nahm
Bismarck die Gelegenheit war, um für beide
Anschläge die von ihm ungeliebte sozialdemokratische Partei verantwortlich zu
machen. Durch die Sozialistengesetze von 1878 wurden die sozialistische Presse
unterdrückt und zahlreiche sozialistische Führer ins Gefängnis geworfen. Die
Sozialdemokratische Partei wurde noch im selben Jahr vom Staat aufgelöst. Trotz
der Unterdrückung durch den Staat ließ sich jedoch der Erfolg der
Sozialdemokraten zukünftig nicht aufhalten. Ihre Zahl nahm weiterhin zu und
gerade die Verfolgung weckte neue Kräfte, die die Regierenden mit Sorge
erfüllten.
Die Sozialgesetzgebung
Bismarck war sich durchaus
bewusst, dass er der
sozialen Frage in Deutschland nicht allein durch negative
Maßnahmen Herr werden konnte. Er sah die Gefahren, die eine steigende
Entfremdung der Arbeiterschaft vom Staat mit sich brachten, und führte zu diesem
Zweck eine Sozialgesetzgebung ein, die den Arbeitern im Falle von Alter und
Krankheit eine Existenzgrundlage einräumte.
Es kam zur Einführung eines
Krankenkassengesetzes sowie Sozialgesetzen im Falle des Unfalls und der
Invalidität. Diese soziale Gesetzgebung wurde in den folgenden Jahren weiter
fortgesetzt. Zudem wurde die Arbeitszeit für Frauen und Kinder eingeschränkt,
die Sonntagsarbeit verboten und eine vom Staat vorgeschriebene Unfallverhütung
vorgeschrieben.
XIX. Bismarcks Außenpolitik nach 1871
Die Isolierung Frankreichs
Der Grundgedanke der deutschen Außenpolitik unter Bismarck war die Isolierung Frankreichs. Die beschämende französische Niederlage von 1870/71 würde nach Ansicht des Reichskanzlers von den Franzosen nicht so leicht vergessen werden. Bismarck rechnete daher mit einer ständigen Gegnerschaft Frankreichs. Als höchste Gefahr galt ihm ein möglicher Zweifrontenkrieg, in dem sich Frankreich und Russland gegen das Deutsche Reich verbündeten. Einem solchen Bündnis musste er somit entgegenwirken und bemühte sich um ein gutes Verhältnis zu Russland.
Der Dreikaiserbund
Nachdem Preußen unter Bismarck zuvor zwischen Österreich und Russland erfolgreich vermittelt hatte, kam es 1872 zum Bündnis der drei Kaiserreiche, in dem die Staaten in ein enges freundschaftliches Verhältnis zueinander traten. Dieses gute Verhältnis wurde aber schon einige Jahre später durch den Russisch-Türkischen Krieg 1877/78 auf dem Balkan schwer erschüttert, in dem Russland die Türken vernichtend schlug. Österreich wollte eine Ausbreitung des russischen Einflusses auf dem Balkan jedoch nicht hinnehmen. Auch England schaute misstrauisch auf die Entwicklung Russlands. Ein europäischer Krieg schien zu drohen.
Der Berliner Kongress
Zwecks dieser Entwicklung, rief
Bismarck zu einem allgemeinen Friedenskongress auf, zu dem sich die europäischen
Regierungen in Berlin 1878 versammelten. Des Reichskanzlers größtes Interesse
galt hierbei der Erhaltung des Friedens, was ihm im Nachhinein als großer
persönlicher Verdienst angerechnet wurde.
Serbien, Rumänien und Montenegro
wurden als selbstständige Fürstentümer von der türkischen Herrschaft abgetrennt.
Bulgarien erhielt größere Freiheit, Bosnien und Herzegowina fielen unter
österreichische, Zypern unter englische Verwaltung. Nur Russland fühlte sich
durch die Ergebnisse des Berliner Kongresses benachteiligt, das
deutsch-russische Verhältnis kühlte merklich ab.
Das Bündnis der Mittelmächte
Bismarck antwortete auf das
nachlassende Verhältnis zwischen dem
Deutschen Reich und Russland mit dem
Abschluss eines deutsch-österreichischen Bündnisses 1879. Russland wurde somit
zum Einlenken gedrängt und unterzeichnete zusammen mit Österreich und Preußen
1881 einen Geheimvertrag, der nach seinem Ablauf wieder erneuert wurde.
Frankreich, das sich
mittlerweile in der Kolonialpolitik engagierte, besetzte 1881 Tunis, das direkt
dem überwiegend italienisch besetzten Sizilien gegenüberlag. Daraufhin schloss
sich Italien dem deutsch-österreichischen Zweibund an und erweiterte ihn
somit 1882 zum Dreibund. Ein Jahr später trat auch Rumänien dem Bund bei.
Die Rückversicherung mit Russland
Nachdem sich 1886 der Dreikaiserbund aufgelöst hatte, war Bismarck erneut um eine freundschaftliche Beziehung zu Russland bemüht. Im Jahre 1887 schloss er daraufhin mit Russland einen Rückversicherungsvertrag, in dem sich Deutschland und Russland Neutralität für den Fall zugestanden, falls eines der beiden Länder angegriffen würde.
XX. Der große Fortschritt der Wissenschaft
Im Laufe der Zeit taten sich immer bedeutendere Erfindungen der Wissenschaft hervor. Insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigten sich die großen Fortschritte der Wissenschaft. Im Zeichen des aufkommenden Positivismus sowie den Lehren Darwins sprach man der Wissenschaft eine immer größere Rolle zu und ging davon aus, dass sich die menschliche Erkenntnis ausschließlich aus Erfahrung und empirischen Wissen über Naturphänomene deduzierte. Literatur und Kunst versuchten daraufhin unter anderem, die Natur so genau wie nur möglich darzustellen.
Ein Überblick einiger
bedeutender wissenschaftlicher Fortschritte:
- 1876: Erfindung des Telefons und des Viertaktmotors
- 1884: Erfindung der Dampfturbine, der Linotype-Setzmaschine und des Füllfederhalters
- 1885: Erfindung des Kraftwagens durch Carl Friedrich Benz.
- 1887: Erfindung des Gummireifens und der Schallplatte
- 1888: Entdeckung der Radiowellen und der Chromosomen
- 1895: Entdeckung der Röntgenstrahlen. Erfindung der Antenne
- 1897: Erfindung des Dieselmotor. Entdeckung der Alpha- und Betastrahlen
XXI. Deutschlands Kolonialpolitik
Nachdem bereits andere Nationen sowie viele deutsche Gelehrte und Forschungsreisende den Kontinent Afrika erforscht hatten, beteiligte sich auch das Deutsche Reich Mitte der 1880er Jahre am Wettlauf der Aufteilung des afrikanischen Territoriums. Dem Bremer Kaufmann Lüderitz folgend, hisste man in Südwestafrika – das heutige Namibia – die deutsche Flagge. Es folgten Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika – das heutige Tansania. Ebenso auf Neuguinea sowie in der Südsee errichtete das Deutsche Reich Kolonien. Diese Kolonialpolitik legte den Grundstein für die zukünftige Weltpolitik des Deutschen Reiches, die der Reichskanzler Bismarck jedoch nur bis zu seiner Entlassung 1890 mitentscheiden konnte.
XXII. Bismarcks
Rücktritt

Kaiser Wilhelm I. starb im Alter
von 91 Jahren am 9. März 1888. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Kronprinz
Friedrich, der jedoch bereits 99 Tage nach der Regierungsübernahme an einem
unheilbaren Halsleiden starb. Ihm folgte sein erst 29-jähriger Sohn
Wilhelm II.
Als
Wilhelm II. an die Macht
kam, zeigte er zunächst tiefe Verehrung für
Bismarck, der unumschränkter zu
herrschen schien, als je zuvor. Das Verhältnis der beiden kühlte sich jedoch
schnell ab, da sich der junge Kaiser nicht vom alternden
Bismarck bevormunden lassen wollte. Im Streit um die Verlängerung des Sozialistengesetzes
verschärfte sich der Konflikt zwischen Kaiser und Kanzler nur noch, da
Bismarck
eine Verlängerung der Bestimmung forderte,
Wilhelm II. seine Regierungszeit
jedoch nicht unter schweren Konflikten mit der Arbeiterschaft beginnen wollte.
Als
Bismarck, anstatt
einzulenken, mit noch schärferen Forderungen kam, die auf Anwendung von
Waffengewalt und gar zur Änderung der Verfassung hinzielten, brach der erzürnte
Kaiser die Verhandlungen mit seinem Kanzler ab und forderte dessen
Rücktrittsgesuch an.
Am 20. März 1890 entließ
Wilhelm II. Otto von
Bismarck aus
seinem Amt.
An dieser Stelle endet der geschichtliche Rückblick auf die deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts.
Diejenigen, die Interesse am weiteren Verlauf der Historie Deutschlands haben, klicken bitte hier.